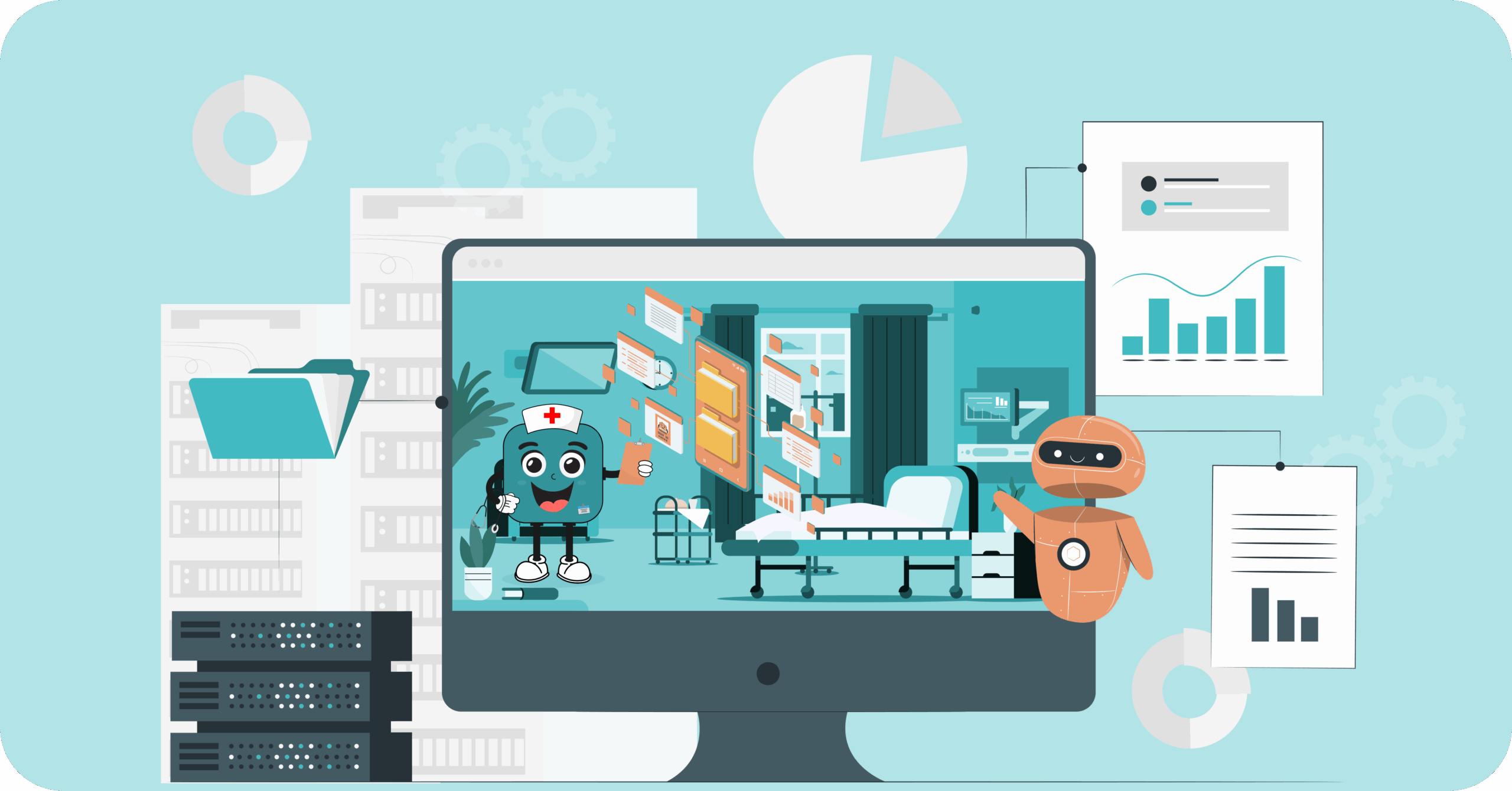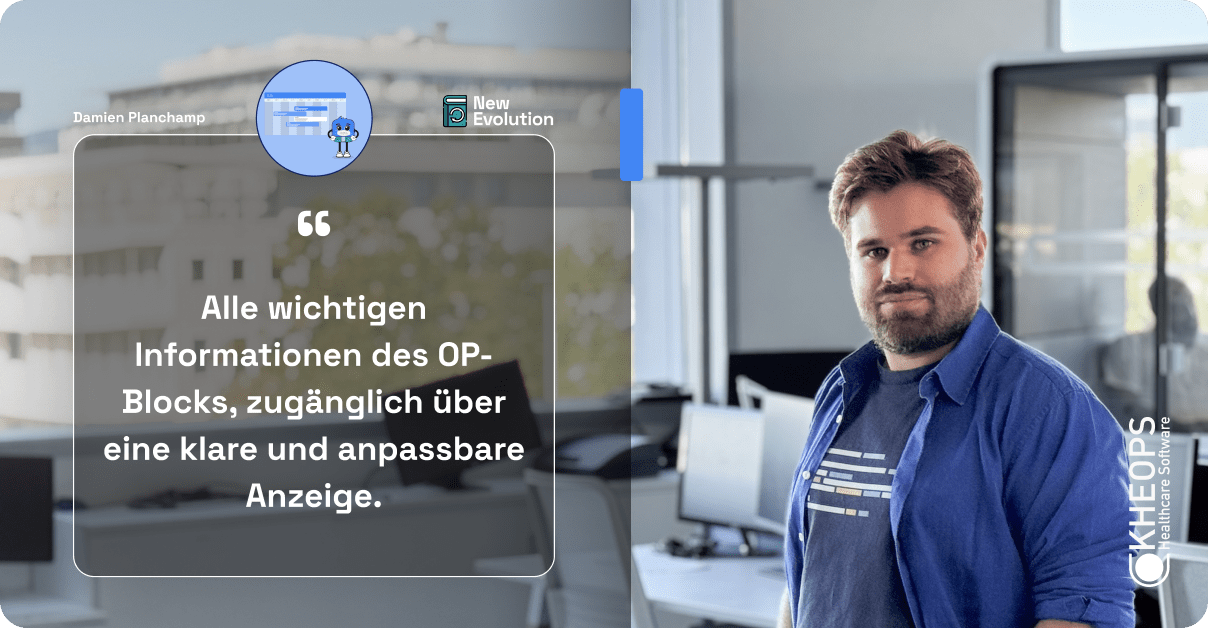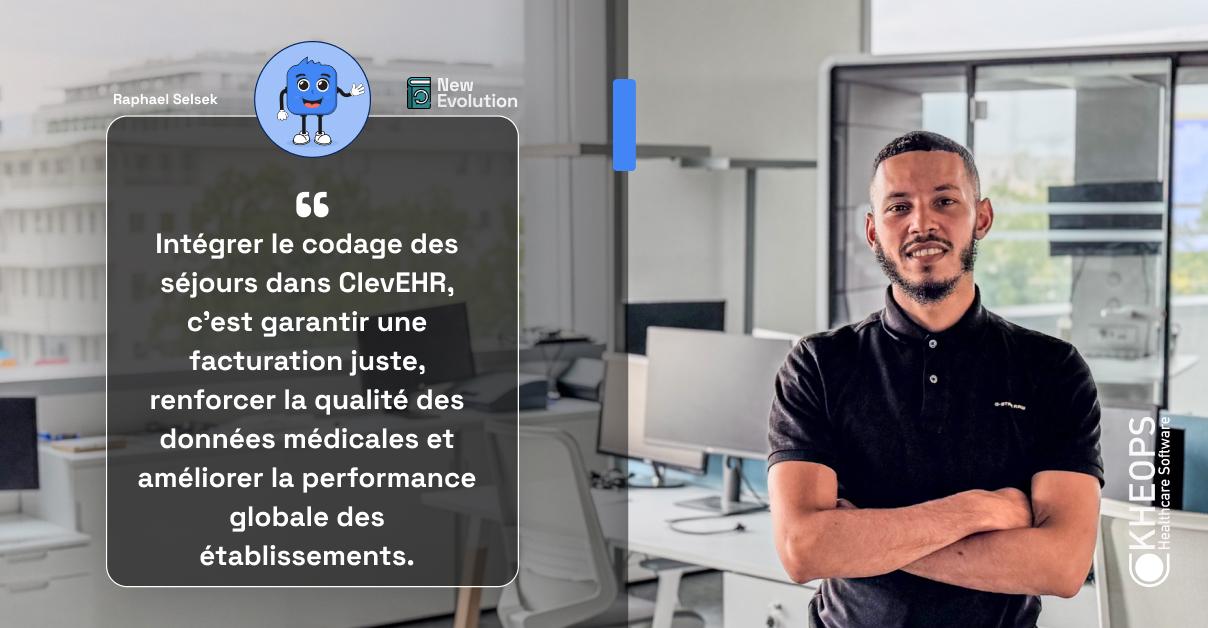Die Interoperabilität der Systeme
Künstliche Intelligenz (KI) gestaltet das Gesundheitswesen neu. Unterstützte Diagnostik, personalisierte Medizin, frühzeitige Erkennung chronischer Erkrankungen, Optimierung von Krankenhausabläufen, Automatisierung zeitaufwändiger Verwaltungsaufgaben … Die Einsatzmöglichkeiten nehmen zu und werden immer präziser. Sie bergen ein enormes Potenzial zur Verbesserung der Versorgungsqualität, zur Senkung der Kosten und zur Entlastung eines stark beanspruchten Systems.
Doch so vielversprechend diese Entwicklungen auch sind – ihre Umsetzung hängt von einer grundlegenden Voraussetzung ab: der Stabilität der zugrunde liegenden digitalen Infrastruktur. Ohne eine geeignete technische Basis kann keine KI-Strategie ihr volles Potenzial entfalten.
KI im Gesundheitswesen : eine laufende Revolution
KI ist längst keine Science-Fiction mehr. Sie kommt bereits in zahlreichen medizinischen Bereichen zum Einsatz: Radiologie, Dermatologie, Onkologie, Kardiologie … Immer leistungsfähigere Algorithmen ermöglichen die Interpretation medizinischer Bildgebung, das Erkennen schwacher Signale in elektronischen Patientenakten oder die Fernbetreuung chronisch erkrankter Patienten.
Für die medizinischen Fachkräfte bedeutet das eine bessere Unterstützung bei Diagnosen und klinischen Entscheidungen. Für die Patientinnen und Patienten führt es zu reibungsloseren, individuelleren und besser koordinierten Behandlungsverläufen. Für das Gesundheitssystem insgesamt bietet KI eine vielversprechende Antwort auf Herausforderungen wie Fachkräftemangel, demografischen Wandel und Kostenkontrolle.
Doch dieser Wandel kann nur gelingen mit einer Infrastruktur, die robust, interoperabel, sicher und zukunftsfähig ist.
Welche zentralen Hürden müssen überwunden werden ?
Die Qualität und Zugänglichkeit der Daten
KI funktioniert durch Lernen. Damit sie zuverlässig ist, benötigt sie große Mengen an strukturierten, hochwertigen und repräsentativen medizinischen Daten. Doch noch immer sind Gesundheitsdaten häufig über verschiedene, heterogene Systeme verstreut, schlecht standardisiert oder schwer nutzbar. Der Übergang zur elektronischen Patientenakte (EPA) war ein erster Schritt, aber die Herausforderung geht weit darüber hinaus: Es braucht eine klare Daten-Governance – von der Erfassung bis zur Analyse.
Die Interoperabilität der Systeme
Technische Silos sind der Feind der KI. Das Fehlen einer reibungslosen Kommunikation zwischen Softwarelösungen, Diensten oder Einrichtungen beeinträchtigt die Kontinuität der Versorgung, verhindert den Austausch wichtiger Informationen und bremst Innovationen. Die Einführung gemeinsamer Austauschstandards (HL7, FHIR usw.) und der Einsatz interoperabler elektronischer Patientenakten sind unverzichtbare Voraussetzungen, damit Intelligenz dort zirkulieren kann, wo sie gebraucht wird.
Sicherheit und regulatorische Konformität
Die Verarbeitung sensibler Daten durch intelligente Algorithmen wirft zentrale Fragen der Cybersicherheit, Vertraulichkeit und rechtlichen Konformität auf. KI im Gesundheitswesen kann sich nur in einem strengen Vertrauensrahmen entwickeln, der den Anforderungen der DSGVO, lokaler Normen (z. B. DSG in der Schweiz) und der Gesundheitsbehörden entspricht. Dies setzt eine vollständige Kontrolle über die gesamte Datenverarbeitungskette voraus – vom Speichern bis zur Nutzung.
Rechenkapazität und Cloud-Infrastrukturen
Moderne KI-Modelle erfordern erhebliche Rechenleistung – oft in Echtzeit – sowie große Speicherkapazitäten. Dies setzt leistungsfähige Cloud-Infrastrukturen voraus, aber auch die Fähigkeit, Cloud-Lösungen mit Edge Computing (lokale oder gerätenahe Verarbeitung) zu kombinieren. Die Herausforderung ist doppelt: Es gilt, eine skalierbare und agile Infrastruktur bereitzustellen und gleichzeitig Datenhoheit und Sicherheit zu gewährleisten.
Was bedeutet „die Infrastruktur vorbereiten“ konkret ?
Die Vorbereitung der Infrastruktur für KI im Gesundheitswesen ist weit mehr als ein IT-Projekt – sie ist ein strategisches und bereichsübergreifendes Vorhaben. Sie beruht auf mehreren komplementären Säulen:
- Gesundheitsdaten von Anfang an absichern, durch Verschlüsselungssysteme, eingeschränkten Zugriff und Nachvollziehbarkeit.
- Vertrauenswürdige Technologiepartner auswählen, die bewährte und skalierbare Lösungen bieten und sich an lokale regulatorische Rahmenbedingungen anpassen können.
- Teams schulen, sowohl medizinisches Personal als auch IT-Abteilungen, in Bezug auf die Herausforderungen und Einsatzmöglichkeiten von KI.
- Eine maßgeschneiderte Cloud- und Edge-Strategie entwickeln, abgestimmt auf die fachlichen Anforderungen, Budgetvorgaben und Sicherheitsanforderungen.
- Testumgebungen (Sandboxes) einrichten, um KI-Lösungen unter realen Bedingungen risikofrei zu erproben.
Eine Chance, die man nicht verpassen sollte
Künstliche Intelligenz darf nicht als Spielerei oder Modeerscheinung betrachtet werden. Sie ist eine disruptive Technologie, die die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems erheblich steigern kann – vorausgesetzt, sie wird methodisch und verantwortungsvoll integriert.
Wer heute nicht in die Infrastruktur investiert, verspielt die Vorteile von morgen. Es reicht nicht aus, fertige KI-Lösungen zu kaufen: Ohne saubere Daten, Sicherheit, Interoperabilität und interne Kompetenzen bleibt selbst der beste Algorithmus wirkungslos.
Ein tiefgreifender Wandel – kein kurzfristiger Trend
KI ist kein Gadget. Sie ist eine disruptive Technologie, die medizinische Praktiken, das Management von Einrichtungen und die Patientenerfahrung neu definiert. Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, müssen wir jetzt in die Grundlagen investieren.
Und Sie – ist Ihre Infrastruktur bereit für KI im Gesundheitswesen?